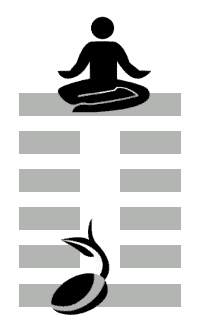Wie ein weit aufgerissenes Maul starrt es ums am, dieses Hexagramm. Furchterregend, unersättlich. Oder auch: annehmend, offen und zu allem bereit….
Es ist gar nicht so einfach, eine Entscheidung zu treffen und ihr dann zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass sich die Dinge fügen werden. Dass dass ich genährt werde, genährt mit allem, was ich brauche.
Dieses Vertrauen verlangt mir viel ab: vertrauensvolles nicht-Handeln. Annehmen und aufnehmen, was sich mir darbietet. Gleichmütig und ohne Wertung, ohne Aufregung, ohne Gefühlsaufwallung.
Und dann? Dann ist es vielleicht an der Zeit, auch wieder loszulassen: Das, was ich nicht mehr brauche. Was überflüssig geworden ist. Vielleicht auch – wieder einmal! – die Kontrolle loszulassen.
Fallstudie
So weit, so gut – aber wie gehen wir nun ganz konkret mit diesem Hexagramm um, beispielsweise wie es eine Nutzerin beschreibt, die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit einem selbstgefälligen und manipulativen Arbeitskollegen hat, der sich immer wieder störend einmischt? Sie schreibt: „Bisher konnte ich mich abgrenzen und mich auf meine eigentliche Arbeit konzentrieren. Aber der Kollege mischt sich immer wieder ein. Ich will mich nicht auf die Spielchen einlassen und auch nicht in mein altes (Opfer-)Muster zurückfallen. Wie kann ich mir selbst treu bleiben und etwas erreichen?“
Das weit aufgerissene Maul von Hexagramm 27 – Ernährung, dieser gierige Schlund, verführt leicht dazu, alles einfach hinunterzuschlucken. Und das tut die Nutzerin, indem sie sich bisher auf ihre eigentliche Arbeit konzentriert – und schweigt.
Aber schon im Akt des „Etwas-in-den-Mund-Nehmens“ liegt eine Entscheidung (unteres Trigramm Zhen, der Donner). Denn wenn uns etwas nicht schmeckt, dann sollten wir es am besten gleich wieder ausspucken, denn dann bekommt es uns in den meisten Fällen auch nicht. Im zwischenmenschlichen Miteinander ist es nicht anders. Uns werden Dinge angeboten – Worte, Gesten, Handlungen – und wir haben die Wahl: Wir können annehmen, aber wir können auch ablehnen. Manchmal brauchen wir etwas Zeit, bis uns unsere Gefühle als verlässliche Wegweiser zeigen, was zu tun ist. Wenn wir für einen Moment ruhig werden und in uns selbst hineinhören (erstes und zweites Kernzeichen, Kun, die Erde), dann zeigen sie uns sehr schnell an, ob uns etwas gut tut – oder eben nicht.
Und dann ist es wieder der Mund, der reagiert: mit Worten, die unser inneres Empfinden ausdrücken. Doch viele Menschen haben sich antrainiert, stark zu sein – und zu schweigen. Sie schlucken, was ihnen nicht gut tut. Sagen nichts. Aus Rücksicht. Aus Gewohnheit. Oder auch aus Angst.
Für unser Gegenüber ist das oft schwer zu deuten. Wenn keine Reaktion kommt, gehen unsere Mitmenschen oft davon aus, dass alles in Ordnung ist. Deshalb braucht es manchmal eine bewusste Selbsterziehung: Die eigenen Gefühle ernst nehmen, ihnen nachspüren – und sie benennen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch als Orientierung für unser Umfeld. Denn nur wenn wir aussprechen, was wir fühlen, es anderen mitteilen, geben wir weniger feinfühligen Mitmenschen die Chance zu verstehen, dass sie mit ihrem Verhalten gerade eine Grenzen überschritten haben. Dass etwas nicht stimmt.
Auch das ist eine Sichtweise auf Gen, der Berg, das obere Trigramm: Wir lassen etwas los, was für einen kurzen (oder längeren) Moment bei und in uns war. Wir lassen etwas los, weil wir spüren, dass wir es nicht wollen. Wir lassen es los wie bei einer verdorbenen Frucht, in die wir versehentlich gebissen haben und die wir auf keinen Fall schlucken wollen. Und geben dieses Etwas in die Welt zurück indem wir zum Ausdruck bringen, dass wir es nicht wollen, dass es nicht zu uns gehört.
Ein kleiner Exkurs (siehe unten) in die psychoanalytische Theorie von Jacques Lacan kann hier hilfreich sein: Er spricht von „Symbolisierung“, d.h. dass das Erlebte symbolisiert, in Sprache gefasst werden muss. Was zunächst kompliziert klingt, ist im Grunde ganz einfach: Gefühle bekommen erst durch Worte ihren Platz. Erst wenn wir benennen können, was uns bewegt, sind wir auch in der Lage, damit umzugehen: es zu bewahren, zu verarbeiten oder vielleicht auch loszulassen.
So zeigt sich das weit aufgerissene Maul nicht nur als Ort der Aufnahme – sondern auch als ein sprechender Mund. Ein Mund, der laut, klar und deutlich ausspricht, was in uns vorgeht.
Weitere Fragestellungen zu Hexagramm 27
- Eine Nutzerin fragt: „Wie soll ich mich einem Mann gegenüber verhalten, den ich näher kennen lernen möchte?“
- Eine weitere Nutzerin beschäftigt sich nun schon seit über einem Jahr mit ihren Verschiedenen „Baustellen“: Hausverkauf, Wohnungs- und Arbeitssuche, partnerschaftliche Neuorientierung. Sie fragt: „Was soll und muss ich noch tun?“ Sie leidet unter der Ungewissheit der Situation und stößt immer wieder auf Blockaden. Allmählich fühlt sie sich sehr erschöpft.
Exkurs: I Ging und Psychoanalyse
Hexagramm 27 – die Ernährung
Schlagworte: Das Unbewusste als strukturierendes Prinzip | Das Symptom als Botschaft | Symbolisierung und orale Fixierung
Ist das offene Maul von Hexagramm 27 – Ernährung – ein Zeichen unstillbarer Gier? Oder Ausdruck einer bereitwilligen Öffnung? Es sind interessante Fragen, die uns das Hexagramm stellt. Bin ich bereit zu empfangen? Traue ich mich, zu vertrauen – dem Leben, dem Anderen, dem, was gegeben wird? Bin ich bereit, meine Bedürftigkeit zuzulassen? Oder will ich alles verschlingen, was sich mir bietet?
Je nachdem, wie die Antwort ausfällt, zeigt sich der Unterschied zwischen Vertrauen und Mangel. Die Haltung des Vertrauens befähigt uns, das, was uns gegeben wird, zu empfangen – ohne Anspruch, ohne Kontrolle. Die Haltung des Mangels hingegen macht uns zu verschlingenden Subjekten, die verzweifelt versuchen, die eigene innere Leere zu bannen.
Was das Subjekt aufnimmt – ob Worte, Bilder, Bedeutungen – prägt es. Alles, was wir aufnehmen, wird Teil von uns: entweder bewusst oder als Teil des Unbewussten. Das Unbewusste ist nach Jacques Lacan kein dunkles Triebbecken (wie es bei Freud oft gelesen wurde), sondern ein strukturierendes Prinzip, vergleichbar mit der Sprache. Es besteht aus Signifikanten, also sprachähnlichen Elementen, die sich verschieben, kombinieren, sich überlagern. Manchmal dringen Botschaften aus dem Unbewussten zu uns, in Träumen, Fehlleistungen, Phantasien, überall dort, wo Sprache und Sinn „aus dem Takt“ geraten.
Doch manches, was wir aufnehmen, bleibt unverdaulich. Wenn wir es nicht symbolisieren können – wenn die Sprache stockt, die Bedeutung sich staut oder verknotet -, erscheint es als Symptom.
In unseren Symptomen können wir der Spur unseres Begehrens nachspüren. Denn jedes Symptom spricht eine bestimmte Wahrheit aus, eine verschlüsselte Botschaft unseres Unbewussten. Lacan beschreibt das Symptom als verdichtete, verkleidete Form unbewusster Wahrheit. Nur wer bereit ist, zuzuhören, erkennt: Das, was mich stört, ist auch das, was mich spricht. Ein Subjekt jedoch, das fixiert bleibt auf das, was es vermeintlich „braucht“, kann diese Botschaft nicht mehr hören. Es verpasst, was das Unbewusste zu sagen versucht.
Alles, was wir aufnehmen und symbolisieren können, lässt sich verwandeln – in Bedeutung, in Ausdruck, in Erkenntnis. Und nur wenn wir auf diese Weise „verdauen“, können wir auch das loslassen, was uns nicht mehr nährt – um neuen Raum in uns zu schaffen.
Denn die Reife des Subjekts zeigt sich nicht darin, dass es „alles hat“, sondern darin, dass es Raum hat – auch für den konstitutiven Mangel selbst.
Die Übersichtsseite zu diesem Hexagramm finden Sie hier:
https://www.no2do.com/hexagramme/788887.htm